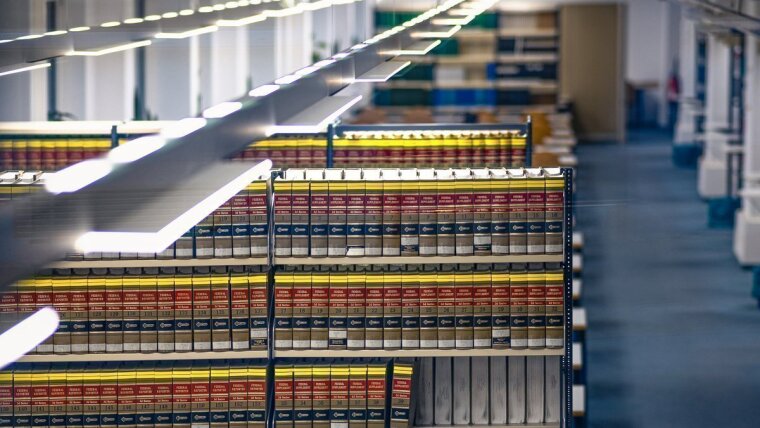
-
Forschungsprojekte
Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte - aktuell
Hochschulen im multiplen Wettbewerb: Veränderungen in Stellenausschreibungen für Professuren 1990 bis 2020 (DFG)
Ziel des Projektes ist es, die Auswirkungen des multiplen Wettbewerbs im Hochschulsystem vor dem Hintergrund seiner zunehmenden Internationalisierung zu analysieren. Dazu sollen Veränderungen in Stellenausschreibungen für Professuren in den Blick genommen werden. Bei der strategischen Positionierung von Hochschulen im multiplen Wettbewerb kommt der Besetzung von Professuren eine entscheidende Rolle zu. Es ist anzunehmen, dass die Anforderungen der verschiedenen Wettbewerbe, in denen sich Hochschulen befinden, sich in Stellenausschreibungen für Professuren wiederfinden. Empirisch fokussiert das Forschungsprojekt auf die Analyse von Stellenausschreibungen für Professuren unterschiedlicher Disziplinen an deutschen Hochschulen zwischen 1990 bis 2020. Basierend auf einer detaillierten Inhaltsanalyse dieser Stellenausschreibungen zielt das Forschungsprojekt darauf ab zu zeigen, wie sich verschiedene Wettbewerbe im Hochschulsystem und insbesondere die zunehmende Internationalität dieser Wettbewerbe über die Zeit in Stellenausschreibungen niederschlagen. Weiterhin sollen die in den Stellenausschreibungen unterschiedlicher Disziplinen und Hochschultypen auftretende Angleichung sowie die beobachtbare Variation mithilfe verschiedener Kontextfaktoren erklärt werden. Methodisch werden sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren genutzt. Theoretisch basiert das Projekt auf institutionalistischen Theorien, insbesondere auf Argumenten des Neo-Institutionalismus (mit besonderem Bezug zur Weltgesellschaftstheorie und Glokalisierungsperspektive), sowie der Imprinting-Theorie. Im Ergebnis werden Beiträge für die Forschung zu multiplen Wettbewerben im Hochschulsystem, zur strategischen Positionierung von Hochschulen und zu institutionalistischen Organisationstheorien erwartet.
Projektleiter: Prof. Dr. Peter Walgenbach
Projektbearbeiterin: Lisa-Maria GerhardtFormation und Wandel von Issue Fields: Eine Längsschnittuntersuchung am Beispiel der Digitalisierung in Deutschland (DFG)
Die neo-institutionalistische Organisationstheorie hat bislang vernachlässigt, die Prozesse der Formation und des Wandels von Issue Fields tiefgreifend zu untersuchen. Es unterbleibt weitgehend, wie es die Theorie eigentlich vorsähe, Felder als soziale Sphären aufzufassen, in denen Organisationen und Organisationsgruppen geteilte Bedeutungen, d.h. ein relationales Sinnsystem, konstruieren. Im vorliegenden Forschungsprojekt sollen deshalb die impliziten Feldprozesse fokussiert werden. Implizite Feldprozesse in Issue Fields meinen, dass sich Organisationen an bereits kommunizierten Bedeutungen orientieren und diese in ihre eigenen kommunizierten Bedeutungen einfließen lassen. Konkret werden in diesem Projekt die Entwicklungspfade von Issue Fields über die Zeit, die Interdependenz des Feldes mit seiner gesellschaftlichen Umwelt, sowie der Einfluss der spezifischen Feldformation und der am Feld teilnehmenden Organisationen zu bestimmten Zeitpunkten berücksichtigt. Die Fokussierung impliziter Feldprozesse ist deshalb bedeutsam, weil besonders diesen evolutionär-sozialen Entwicklungen ein signifikanter Anteil am Wandel einer Gesellschaft zugeschrieben wird. Als Untersuchungsobjekt wird das Issue Field, welches sich um das Thema der "Digitalisierung" der Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland formiert, empirisch untersucht. Methodisch wird ein Mixed-Method-Ansatz genutzt, der eine quantitative, (computer-)linguistisch gestützte Analyse und flankierendes "close reading" zur Untersuchung von Sprachdaten aus der Bundesrepublik Deutschland im Längsschnitt (2000-2018) kombiniert. Als Datengrundlage werden Presseerzeugnissen sowie Organisationsveröffentlichungen herangezogen. Die beantragte Studie zielt darauf, Implikationen sowohl für die Feldtheorie des Neo-Institutionalismus, als auch den wissenschaftlichen Diskurs über die Digitalisierung abzuleiten.
Projektleiter und -bearbeiter: Dr. Jan Goldenstein
Projektbearbeiter: Philipp PoschmannDrittmittelfinanzierte Forschungsprojekte - abgeschlossen
Die kulturelle Konstruktion von Unternehmensverantwortung (DFG)
Die vorliegende Literatur vernachlässigt weitgehend die Bedeutungsdimension des Konzeptes Unternehmensverantwortung. Was Verantwortung ist oder nicht, ist stets Ausdruck einer sozialen Konstruktion. Der Weltkultur-These im Neo-Institutionalismus folgend, müsste sich das kulturell geteilte Verständnis von Unternehmensverantwortung global angeglichen haben. Dementsprechend verbreitet sich Unternehmensverantwortung nicht nur als allgemeiner, inhaltsneutraler Begriff oder in Form von Praktiken, sondern auch auf einer normativen und kognitiven Ebene. Im vorliegenden Forschungsprojekt wollen wir diesen bislang nur angenommenen Angleichungsprozess empirisch untersuchen. Dazu wollen wir einerseits mithilfe quantitativer (computer-)linguistischer Analysemethoden am Beispiel dreier, für die Weltökonomie bedeutsamen, Länder (Deutschland, Großbritannien, USA) im Längsschnitt (1950-2015) das kulturelle Verständnis von Unternehmensverantwortung untersuchen. Mit diesem Vorgehen wollen wir den vermuteten Wandel des Verantwortungsverständnisses im Zeitverlauf sichtbar machen. Andererseits soll parallel hierzu vor dem Hintergrund der Wirtschaftsgeschichten der drei Länder die bisherige Literatur zur Unternehmensverantwortung in historischer Perspektive systematisch aufgearbeitet werden. Anschließend sollen beide Seiten der Analyse zusammengeführt und unsere Forschungsfragen einer empirischen Untersuchung unterzogen werden. Die beantragte Studie zielt darauf, Implikationen sowohl für die Theorie des Neo-Institutionalismus, als auch den wissenschaftlichen Diskurs über die Verantwortung von Unternehmen abzuleiten.
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Walgenbach
Projektbearbeiter: Dr. Jan Goldenstein und Dr. Philipp PoschmannBestandsaufnahme: Führungsverantwortung als Thema in Forschung & Lehre (Carl-Zeiss-Stiftung)
Die gesellschaftliche Diskussion über die Verhaltensweisen von Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft wirft die Frage auf, welche Rolle das Thema "FührungsverantwortungExterner Link" an den Hochschulen in Forschung und Lehre spielt. Durch eine aussagekräftige Bestandsaufnahme der derzeitigen Verankerung und Bedeutung des Themas "Führungsverantwortung" in Forschung und Lehre an den Universitäten der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen soll die Studie Empfehlungen für Fördermaßnahmen formulieren, die an die Praxis anschlussfähig sind und damit der gesellschaftspolitischen Verantwortung der Hochschulen gerecht werden.
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Walgenbach
Projektbearbeiterin: Stefanie WüstenhagenUmsetzung und Anpassung der Managementkonzepte Shareholder Value und Corporate Social Responsibility (DFG)
Mit diesem Projekt wollen wir an die jüngere Literatur zur Übernahme und Übersetzung von Managementkonzepten auf der Basis der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie anschließen, aber zugleich in zweierlei Hinsicht über diese hinausgehen. Bisher konzentrierte sich die Forschung lediglich auf die Implementierung eines Konzeptes oder inhaltlich verwandter Konzepte. Diese Herangehensweise blendet aus, dass die von Unternehmen übernommenen Managementkonzepte zueinander nicht nur in einem komplementären oder neutralen, sondern auch in einem konkurrierenden (im Extremfall widersprechenden) Verhältnis stehen können. Zudem wurde der eigentliche Übersetzungsprozess noch nicht systematisch im Zeitverlauf untersucht. Die eigentlichen Übersetzungsleistungen wurden insofern bisher nicht erfasst, sondern nur die Ergebnisse der Übersetzungsprozesse. Im hier beantragten Projekt wollen wir mithilfe qualitativer Forschungsmethoden untersuchen, wie vordergründig einander widersprechende Managementkonzepte, nämlich Shareholder Value und Corporate Social Responsibility, übersetzt und in organisationale Kontexte eingeführt werden.
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Walgenbach
Projektbearbeiter: Dr. Stephan Bohn und Dr. Anne GalanderMultinationale Unternehmen, regionale Governance und Human Resource Management (DFG)
Das Forschungsvorhaben untersucht die Interaktion zwischen Governanceakteuren sowie Aus- und Weiterbildungsorganisationen, z.B. Universitäten, mit multinationalen Unternehmen auf regionaler Ebene; die erfolgt in zwei Regionen in den alten und neuen Bundesländern. Das Projekt ist Teil eines internationalen Forschungsprojekts mit vergleichbaren Untersuchungen in je zwei Regionen der Länder Großbritannien, Irland, Kanada und Spanien. Ziel des Projektes ist es zu untersuchen, wie Governanceakteure sowie Aus- und Weiterbildungsorganisationen mit multinationalen Unternehmen interagieren und wie diese Beziehungen die Nachfrage nach und das Angebot von Humanressourcen sowie die regionale Einbettung von multinationalen Unternehmen prägen. Vor dem Hintergrund des internationalen Wettbewerbs zwischen Regionen um wertschöpfende Unternehmensinvestitionen und der zunehmenden Regionalisierung der Industriepolitik haben diese Aspekte eine hohe Relevanz. Sie werden durch eine qualitative Untersuchung von kritischen Ereignissen in der Interaktion zwischen regionalen Akteuren und multinationalen Unternehmen sowie eine soziale Netzwerkanalyse erfoscht.
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Walgenbach
Projektbearbeiterin: Dr. Eva Schlindwein -
Jena Computational Organizational Research Applications (JenCORA)
Mehr erfahren enThe Group for Jena Computational Organizational Research Applications (JenCORA) focusses on automatic text analysis based on machine learning. We apply text-mining tools to the domains of management and organizational studies.
-
Jena Organization Corpus (JOCo)
JOCo is a corpus of annual reports (ARs) and corporate social responsibility (CSR) reports of US American, British and German business organizations, i.e. corporations, which are listed in the main indices such as DOW JONES, S&P 500, and NASDAQ 100 for the USA; FTSE, FTSE AIM 100, FTSE 250 for Great Britain; DAX, MDAX, and TecDAX for Germany. All reports are in English: the German corporations provide reports in English for their international audiences as well. For a more detailed description of the corpus please refer to our paper:
Sebastian G.M. Händschke, Sven Buechel, Jan Goldenstein, Philipp Poschmann, Tinghui Duan, Peter Walgenbach, and Udo Hahn. 2018. A Corpus of Corporate Annual and Social Responsibility Reports: 280 Million Tokens of Balanced Organizational Writing. In ECONLP 2018 Proceedings of the First Workshop on Economics and Natural Language Processing @ ACL 2018. Melbourne, Australia, July 20, 2018. Pages 2031.
JOCo is intended to be used in a shared community effort to improve natural language processing techniques for the economic language domain as well as in the domains of business and management.
JOCo is provided by the Chair of Organization, Leadership, and Human Resource Management, Prof. Dr. Peter Walgenbach, and the Chair of Computational LinguisticsExterner Link, Prof. Dr. Udo Hahn, both of Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany.How to get the corpus?
1. All users of JOCo must apply for a license in order to receive a copy (data_use_agreement_jocopdf, 25 kb).
2. Please send the data use agreement to Dr. Philipp Poschmann (subject: "JOCo data use agreement").
3. In the following days, you will receive a download link, which is valid for 20 days.
4. If the JOCo is updated, you will receive an e-mail announcement including a link to the new version of the corpus. If you do not wish to receive this e-mail announcement, please send a short message.